Die
erwartete Verlangsamung des über
Jahre stetig hohen Wachstums in
China könnte die dortige Nachfrage
nach deutschen Autos belasten.
Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb
durch chinesische
Automobilhersteller in China, aber
auch auf den heimischen Märkten zu.
Was das für die deutsche
Automobilindustrie zu bedeuten hat,
die zuletzt einen erheblichen Teil
ihrer Gewinne in China
erwirtschaftet hat, erläutert die
Prognose. In der aktuellen
Blitz-Licht-Analyse beleuchten die
Analysten der KfW IPEX-Bank die
Auswirkungen der Entwicklungen in
China auf die deutsche
Automobilindustrie und die kurz- bis
mittelfristigen Chancen und
Herausforderungen, die sich daraus
ergeben.
|
|
 |
| |
IAA 2017 in
Frankfurt |
Deutsche Autobauer - vor allem die
OEM-Premiummarken - profitieren seit
Jahren vom wirtschaftlichen
Aufschwung Chinas. Die erhebliche
Absatz- und Gewinnverschiebung der
letzten Jahre zu Gunsten der
Volksrepublik führte zu einer
deutlichen Abhängigkeit. Nun drohen
die hohen Margen im Reich der Mitte
durch eine Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums und
aufstrebende chinesische
Wettbewerber unter Druck zu geraten.
Chinas schneller Aufstieg zum
weltweit größten Pkw-Markt
Das hohe Wirtschaftswachstum Chinas
und der damit verbundene Aufstieg
zur zweitgrößten Volkswirtschaft der
Welt wirkten sich sehr positiv auf
die Automobilindustrie aus. Die
steigenden Einkommen und die
aufstrebende Mittelschicht sowie die
niedrige Pkw-Dichte führten in der
Zeit nach der Fi- nanzkrise bis zum
Peak 2017 zu einem stark steigenden
Pkw-Absatz im Reich der Mitte (Greater
China*: ~10 Prozent vs. Global: ~5
Prozent CAGR 09-17). Die Nachfrage
wurde jedoch seit 2018 durch
Handelskonflikte, die COVID-19-
Pandemie und die
Lieferkettenstörungen belastet.
*Greater
China:
Volksrepublik
China
(Festland,
Hongkong,
Macau)
und Taiwan
Die Volksrepublik entwickelte sich
schnell zum weltweit größten Pkw-
Absatzmarkt: Chinas Anteil stieg (in
einem weltweit bis 2017 wachsenden
Pkw-Markt) von ~20 Prozent 2009 auf
mehr als 30 Prozent im Jahr 2021.
Dagegen entwickelte sich bspw. der
Anteil des gesättigten europäischen
Markts im gleichen Zeitraum von
knapp 29 Prozent auf weniger als 21
Prozent rückläufig.
Absatzmarkt China – ein
Klumpenrisiko für die deutschen
Autobauer
Insbesondere die stark wachsende
Mittelschicht in China verhalf der
deut- schen Automobilbranche zu
einem andauernden und profitablen
Wachstum. Die jährlichen
Steigerungsraten der Premiummarken
lagen deutlich über dem bereits
hohen Wachstum des chinesischen
Pkw-Markts. In der Folge stieg der
China-Absatzanteil deutscher OEM
stetig an. Mittlerweile liegen die
Anteile weit über 30 Prozent (laut
IHS bei der VW-Tochter Audi sogar
bei 43 Prozent). Aufgrund der
robusten Pkw-Nachfrage in China
während der COVID19- Pandemie ist
die Abhängigkeit sogar noch
angestiegen. Zusammen verfü- gen die
deutschen Hersteller in China über
einen Marktanteil von rund 20
Prozent.
Ausländische Autobauer zu Joint
Ventures (JV) gezwungen
Um Fahrzeuge in China zollfrei
verkaufen zu dürfen, mussten alle
ausländi- schen Hersteller Joint
Ventures (max. 50
Prozent-Beteiligung) mit heimischen
OEM eingehen und
Produktionsstandorte vor Ort
errichten. So ging Volks- wagen JVs
mit FAW und SAIC, Mercedes Benz mit
BAIC und BMW mit Bril- liance ein.
Für die Zulieferindustrie gab es
diese Anforderung nicht.
Mit dieser Industriepolitik
entwickelte sich das Reich der Mitte
nicht nur zum weltweit größten
Pkw-Absatzmarkt, sondern in
ähnlichem Umfang auch zum größten
Pkw-Produzenten (2021: ~25 Mio.
Einheiten). Die Lokalisierung führte
dazu, dass die deutschen OEM 2019
erstmals deutlich mehr Pkw in China
(~5 Mio.) fertigten als an den
heimischen Produktionsstandorten.
|
 |
 |
Erlöse aus dem China-JV-Absatz
fließen nicht in den Konzernumsatz
ein
Aufgrund der fehlenden Beherrschung
der China-JV werden die erzielten
Erlöse aus dem Verkauf der vor Ort
produzierten Pkw nicht im Konzernum-
satz der deutschen Hersteller
berücksichtigt. Durch die
Bilanzierung nach der sog. „At-Equity-Methode“
wird lediglich das anteilige
JV-Ergebnis sowie die JV-Beteiligung
in der Bilanz ausgewiesen. Anders
sieht es bei der Berichterstattung
der Absatzzahlen aus. Hier fließen
auch die in den China-JV
produzierten Pkw mit ein. Die
Konsequenz ist eine Diskrepanz
zwischen den Absatz- und
Umsatzanteilen. Die ausgewiesenen
Konzernumsatzanteile von China
liegen bei etwa 20 Prozent und
setzen sich wie folgt zusammen:
1. Dem Export von Fahrzeugen
nach China. Hier wird ein Zoll von
25 Prozent erhoben, was im
Wesentlichen nur bei Premium-Autos
durchsetzbar ist.
2. Der Vereinnahmung von
Lizenzgebühren (~3 Prozent des
Fahrzeugpreises) für jedes in China
JV-produzierte und verkaufte
Fahrzeug.
3. Teile und Komponenten die
außerhalb Chinas produziert und an
die JVs verkauft werden (Anteil
hängt von dem Grad der Lokalisierung
ab).
Fazit: Die Profitabilität des
China-Geschäfts lässt sich kaum
genau ermitteln. Branchenkenner
schätzen, dass die drei Autokonzerne
gewöhnlich rund die Hälfte ihres
gesamten Profits in China
erwirtschaften. Die ausgewiesenen
anteiligen JV-Gewinne stellen damit
nur einen Teil der „China-Gewinne“
dar.
Deutsche Autobauer streben die
Mehrheitsbeteiligung an den
China-JVs an
Peking kündigte 2018 an, die
Obergrenzen für JV-Beteiligungen im
Automo- bilsektor bis 2022
aufzuheben. Da die JV sehr
profitabel sind und wichtige
Beiträge zum Konzernergebnis der
Autohersteller leisten, besteht
seitens der OEM ein sehr hohes
Interesse, die Mehrheit an den JV zu
erlangen. Damit würde der Umsatz
deutlich zulegen und die operativen
Margen ten- denziell steigen. BMW
gelang 2022 als erstem OEM die
Mehrheitsübernah- me an seinem
China-JV. Mercedes und VW hatten
bislang keinen Erfolg.
Mit der Elektromobilität schwinden
die hohen Markteintrittsbarrieren…
Die Autoindustrie wird von Peking
als eine der Schlüsselindustrien
angese- hen. Man will ein führender
globaler Akteur in der Branche
werden. Das ehrgeizige Ziel könnte
auf dem Markt für E-Autos gelingen:
Mit der Trans- formation der
Antriebstechnik besteht die
Möglichkeit, den technologischen
Vorsprung der Deutschen bei den
Verbrennungsmotoren zu überspringen.
Chinas Autobauer profitieren
einerseits von einer erheblichen
staatlichen Förderung und
andererseits von einem großen und
nachfragestarken Markt. So ist mit
etwa 3,5 Mio. verkauften E-Autos
2021 (BEV ~3 Mio. und PHEV 0,5 Mio.)
die Volksrepublik neben Europa (~2,3
Mio.) bereits der wichtigste Markt
für E-Autos. Der E-Auto-Anteil stieg
2021 auf ~14 Prozent (2020: 5,4
Prozent).
BYD erreichte 2021 in China bei den
sog. NEV** einen Marktanteil von
knapp 20 Prozent. Dagegen verfügen
die deutschen OEM aufgrund des über-
schaubaren NEV-Angebots in dem
Segment derzeit nur über einen
geringen Marktanteil von ca. 5
Prozent.
**New
energy
vehicles:
BEV
=
Battery
electric
vehicles;
PHEV
=
Plug-in
hybrid
electric
vehicles;
FCEV
=
Fuel-cell
electric
vehicles
…und das Wettbewerbsumfeld
intensiviert sich
Chinesische OEM (z.B. NIO, BYD,
XPeng, Great Wall Motors, Geely, Li
Auto, Aiways) sind auf dem Weg,
ernst zu nehmende Rivalen deutscher
Hersteller zu werden. Nicht nur weil
die Chinesen konsequent auf
E-Mobilität setzen, sondern sich
auch auf Software und
Digitalisierung fokussieren. Die in
China hergestellten Modelle fordern
deutsche OEM bei Bedienung (Enter-
tainment/Vernetzung) und der
Batterietechnik. Aber auch
chinesische Tech- Konzerne (z.B.
Xiaomi) treiben die E-Offensive
voran. Andere wie Huawei, Baidu,
Alibaba und Tencent arbeiten mit der
Autoindustrie zusammen.
Chinesische Pkw-Exporte werden
zunehmen
|
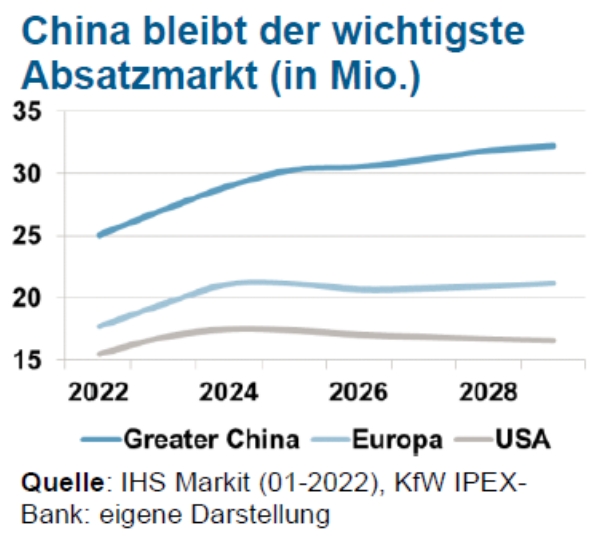 |
|
2021 entfiel etwa die Hälfte der
weltweit verkauften E-Autos (~6,5
Mio.) auf chinesische Automarken –
bei weniger als 15 Prozent Anteil am
globalen Pkw- Markt. Ein Großteil
der E-Autos entfällt damit noch auf
die Binnennachfrage. Laut dem 2020
verkündeten 15-Jahresplan
(2021-2035) wünscht Peking eine
Export-Offensive für E-Autos und
wird einheimische Unternehmen un-
terstützen. Es ist zu erwarten, dass
die chinesischen Exporte von E-Autos
schnell steigen dürften, was auf die
Faktoren (1) überschüssige
Kapazitäten (2) schwächere
Binnennachfrage (3) bessere Qualität
zurückzuführen ist. Dabei weckt der
schnell wachsende europäische
E-Automarkt Begehrlich- keiten und
die chinesischen Hersteller drängen
verstärkt auf diesen Markt (ein
beliebter Start aufgrund der hohen
E-Auto-Anteils ist Norwegen). Ihr
Marktanteil in Europa liegt
allerdings aktuell bei noch
überschaubaren rund 1,2 Prozent.
Die günstigen Preise dürften
zunächst vor allem
Volumenherstellern (Ford, Fiat,
Opel) Marktanteile abnehmen. Aber
auch für die Premiumhersteller wird
der Wettbewerbsdruck zunehmen (z.B.
Aiways U5/U6 oder Nio ET7).
Markteintritte über Beteiligungen an
westlichen Marken sind bereits
erfolgt. So ist Geely mit Volvo Car,
Polestar, Lotus, Smart oder Lynk
vertreten. SAIC übernahm die
britische Marke MG und verkauft
Elektro-SUVs in Europa.
Künftiges Wachstum des chinesischen
Pkw-Marktes wird geringer ausfallen
China steht vor diversen
Herausforderungen, welche sich auch
auf die hei- mische Pkw-Nachfrage
auswirken werden. Kurzfristig sind
hier verstärkte Lockdown-Maßnahmen
durch die Null-COVID-Strategie und
Produktionsbe- hinderungen durch
Lieferengpässe zu nennen.
Langfristig hemmen eine stagnierende
und alternde Bevölkerung sowie ein
rückläufiger Anteil der
arbeitsfähigen Menschen die
Nachfrage. Hinzu kommt die Gefahr
eines sich abschwächenden
Immobilienmarkts. Generell wird
erwartet, dass sich das chinesische
BIP-Wachstum in den kommenden Jahren
abschwächen wird. Ein erneutes
Aufflammen des weiterhin schwelenden
Handelskonfliktes zwischen den USA
und China sowie die Bekämpfung der
stark gestiegenen Ungleichheit im
Reich der Mitte (Stichwort „Common
Prosperity“), können die Wirtschaft
und die Nachfrage nach Luxuswagen
zusätzlich belasten.
Die künftigen jährlichen
Pkw-Wachstumsraten werden wohl
deutlich unter dem Niveau vor der
Corona-Pandemie liegen (CAGR
2022-2029 ~3,7 Prozent; Global ~3
Prozent). Stützend wirkt die im
Vergleich zu den Industrienationen
im- mer noch geringe Pkw-Dichte (214
Fahrzeuge pro 1.000 Einwohnern in
2021; Vgl. USA: 800).
Die Herausforderungen und Risiken
für die Autobauer sind vielfältig
Der chinesische Markt besitzt allein
durch seine Größe einen immensen
Stellenwert mit
Trendsetzungscharakter. Die
Sicherung der Profite und
Marktanteile durch die richtige
Kundenansprache ist sehr wichtig
(Fokus der Produktstrategie u.a. auf
Software, Entertainment,
Vernetzung).
Um nicht den Anschluss an die
wachsende Konkurrenz zu verlieren
und um auf Wohlwollen der Regierung
zu stoßen, verschieben deutsche OEM
ver- stärkt Wertschöpfung nach China
(Entwicklung, Produktion z.B. von
Smart, Mini sowie SUVs). Die
Verlagerung ist vor dem Hintergrund
des mög- lichen Verlusts von
Technologie Know-how kritisch zu
sehen.
Die hohen Absatzanteile jenseits von
30 Prozent zeigen, wie abhängig die
Geschäftsmodelle der deutschen
Autobauer von der wirtschaftlichen
Entwicklung der Volksrepublik sind.
Das Klumpenrisiko sowie die
wachsende Konkurrenz aus dem Reich
der Mitte bergen nicht unerhebliche
Risiken. Weiterhin können aktuelle
Sanktions-Diskussionen auf EU-Ebene
sowie politische oder regulatorische
Eingriffe seitens Peking sich
negativ auf die Profite der
deutschen Autobauer auswirken.
Fazit: Der "Motor" China kommt ins
Stottern
Aufgrund schwächerer
Wachstumserwartungen sowie
tendenziell sinkender Renditen durch
die zunehmende Konkurrenz, ist davon
auszugehen, dass sich das hohe
profitable Wachstum der
Vergangenheit nicht fortschreiben
lässt. Insgesamt sehen wir die
deutschen Autobauer im
Oberklassesegment kurz- bis
mittelfristig gut positioniert und
gehen davon aus, dass sie am
chinesischen Wachstumspotenzial
weiterhin partizipieren können.
Da andere Absatzmärkte das
„China-Geschäft“ schlicht nicht
ersetzen können, gilt es für die
OEM, auf die Herausforderungen und
Risiken des chine- sischen Marktes –
wie in der Automobilindustrie üblich
– flexibel zu reagieren. Das
bedeutet, auf die besonderen
Kundenbedürfnisse stärker einzugehen
und Chancen (z.B. durch M&A der
JV-Aktivitäten) zu ergreifen.
Foto (c)
Kulturexpress, Meldung: Mladen Hucic
– Kreditanalyse Automobilindustrie –
KfW IPEX-Bank, Frankfurt am Main