Aufgrund des hohen
Wohnungsbedarfs in der DDR musste
innerhalb kürzester Zeit eine große
Anzahl an Wohnungen für die
Bevölkerung geschaffen werden.
Architekten bedienten die
politischen Vorgaben zeitgemäß mit
Typenprojekten, die sie in der
gesamten DDR in Serienfertigung
errichteten. Die Serientypen konnten
vielfältig variiert werden, und jede
Planung war auf Effektivität
ausgerichtet. Damit sollte die
Wohnungsfrage als soziales Problem
gelöst werden.
|
|
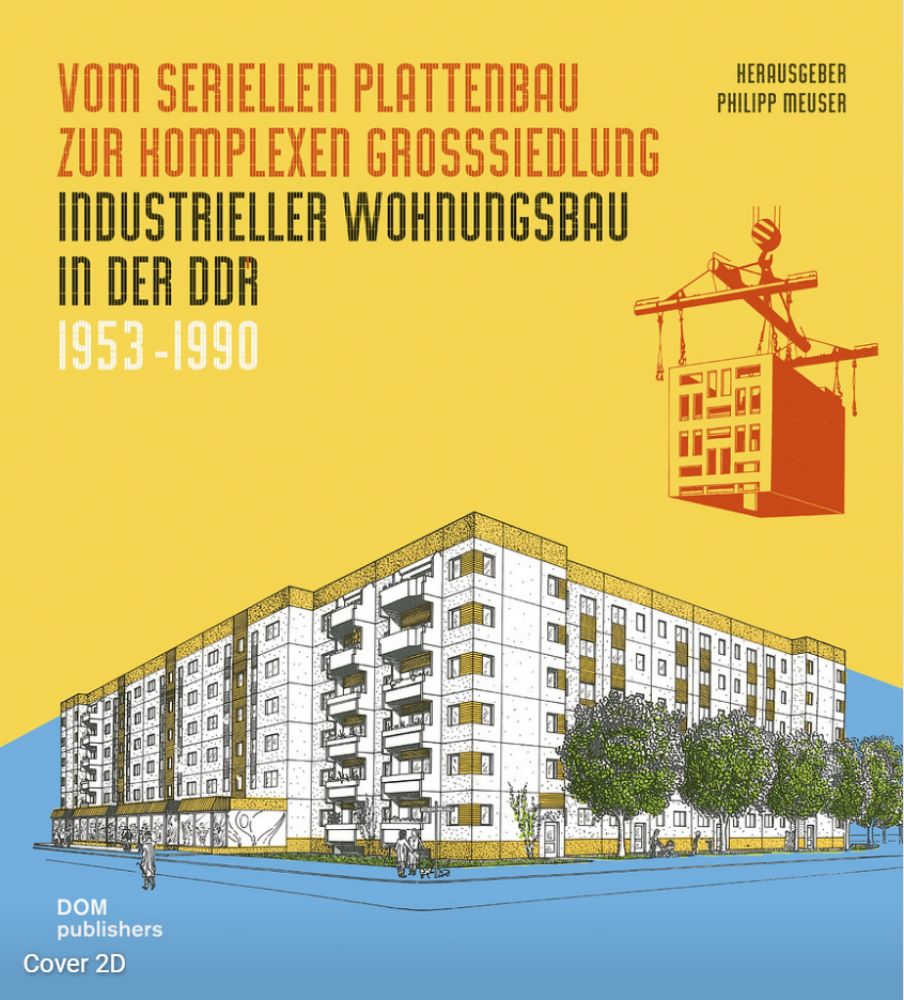 |
| |
Buchcover |
Die Entwicklung des industriellen
Wohnungsbaus ist ein zentraler Teil
der DDR-Architekturgeschichte und
wird nun in der zweibändigen
Publikation Vom seriellen Plattenbau
zur komplexen Großsiedlung.
Industrieller Wohnungsbau in der DDR
1953 bis 1990 erstmals systematisch
dargestellt. Denn obwohl die
Alltagskultur der DDR und das Wohnen
im Plattenbau seit dem Fall der
Mauer bereits aus vielen Winkeln
betrachtet wurden, ist eine
bautypologische Systematisierung aus
architektonischer und
baukonstruktiver Sicht bislang noch
nicht vorgelegt worden. Auch deshalb
werden in den einzelnen Texten die
Konstruktion und der Bauprozess –
denn der industrielle Wohnungsbau
ist primär eine
ingenieurwissenschaftliche Disziplin
– und weniger die
architektursoziologischen Aspekte
betrachtet. Beginnend im Jahr 1953
mit dem ersten Versuchsbau in
Plattenbauweise, werden in
übersichtlichen Kapiteln
geschichtliche Hintergründe und
architektonische Merkmale
herausgearbeitet und beschrieben.
Der baukulturelle Wert des
Wohnungsbaus kommt in den
zahlreichen Fassadendekorationen
ebenso zum Ausdruck wie in
experimentellen
Konstruktionsverfahren. Im zweiten
Band befassen sich namhafte Autoren
mit dem Wohnungsbau der DDR im
städtebaulichen Maßstab: mit neuen
Städten, komplexen Großsiedlungen
und der in den späten
Siebzigerjahren beginnenden
Erneuerung der Innenstädte.
 |
 |
|
Blockrandbebauung an der
Köpenicker Straße /Ecke
Heinrich-Heine-Straße in
industrieller Vorfertigung
(1989)
|
Französische
Straße 28 – 29, Berlin
|
|
|
 |
| |
Linke Seite:
Ersatzneubauten in der
Nördlichen Altstadt von
Rostock, Blick in den
Innenhof der Häuser
Aalstecherstraße 1 – 3 und
Badstüberstraße 1 – 2 |
Diese Publikation ist ein Plädoyer
für ein besseres Verständnis der
ostdeutschen Plattenbaugeschichte.
Sie will dazu anregen, den
industriellen Wohnungsbau in der DDR
nicht nur auf das politische
Programm eines sozialistischen
Gesellschaftsmodells zu reduzieren.
Dreißig Jahre nach dem Ende der DDR
gilt es, ihren industriellen
Wohnungsbau als einen Beitrag zur
Architekturgeschichte des 20.
Jahrhunderts anzuerkennen. Denn die
DDR war auf dem Gebiet des
industriellen Bauens international
führend.
Zeitgleich erscheint ein
Interview-Band mit Akteuren und
Akteurinnen, die in verschiedenen
Positionen am Planen und Bauen in
der DDR mitgewirkt haben. In
Architektur und Städtebau in der
DDR. Stimmen und Erinnerungen aus
vier Jahrzehnten sind gehaltvolle
und zugleich lebendige Dialoge über
die Praxis von Architektur und
Städtebau in der DDR zu lesen.
Foto ©
Philipp Meuser,
Meldung:
Gisela Graf
communications, Freiburg i. Brsg.
Vom seriellen
Plattenbau zur komplexen
Großsiedlung.
Industrieller Wohnungsbau in der DDR
1953 bis 1990
Band 1: Historischer Kontext,
Serientypen und bezirkliche
Anpassungen
Band 2: Neue Städte,
Großsiedlungen und Ersatzneubauten
(Hrsg.) Philipp Meuser
Mit Beiträgen von Jörg Blobelt, Jörn
Düwel, Wolf-Rüdiger Eisentraut,
Florian Heilmeyer, Uta Keil, Mathias
Körner, Christoph Liepach, Juliane
Richter, Björn Rosen, Oliver Werner,
Anselm Weyer.
DOM publishers, Berlin
1. Auflage, 2022
Fotoessay von Maurizio Camagna
368 Seiten je Band
950 Abbildungen, Hardcover mit
Schutzumschlag
Format: 210 × 230 mm
978-3-86922-859-4 (Band 1+2)